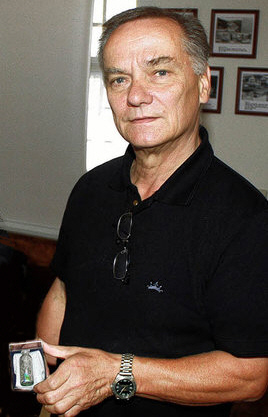|
|
|
Das "Krone-Fläschchen" könnte über
500 Jahre alt seinIm Wirtshausmuseum
"Krone" in Tegernau wurde ein für den gesamten süddeutschen Raum
einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit gefunden.

Sechs cm lang, 2 cm im Durchmesser, ordentlich eingestaubt und mit Resten
eines unbekannten Etwas im Inneren, so präsentierte sich das
"Krone-Fläschchen" eher unscheinbar, als Hans Viardot es bei
Restaurierungsarbeiten im Tegernauer Wirtshausmuseum "Krone" in einem
Sandbett unter den Pflastersteinen des Küchenfußbodens entdeckte.
Mittlerweile jedoch ist klar: Das Glasfläschchen ist ein im ganzen
süddeutschen Raum einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit: Es legt
zunächst eine ungewöhnlich weit zurückreichende Spur zur alten
Handwerkskunst der Glasmacherei. Darüber hinaus jedoch birgt es in seinem
Inneren vermutlich Reste eines "Schutzzaubers" und verweist damit auf
spätmittelalterlichen (Aber-)glauben und hergebrachte Hausschutz-Rituale.
Damit ist das Krone-Fläschchen "das älteste und beinahe einzige Exemplar
eines solchen Schutzzaubers im ganzen süddeutschen Raum", attestierte
Werner Störk als Kenner der hiesigen Glashütten-Historie.
Bemerkenswert am "Krone-Fläschchen" ist zunächst sein Alter: Verschiedene
Merkmale bewegen Störk dazu, das Kleinod auf das 14. oder 15. Jahrhundert
zu datieren, und damit in die Frühzeit der Schwarzwälder Glashütten.
Zunächst ist da die grüne Farbe des Glases: Ein charakteristisches Merkmal
der Glasproduktion bis ins 17. Jahrhundert hinein. Verantwortlich für
diese Färbung ist das Eisenoxid im Quarzsand, der wiederum den
wesentlichen Rohstoff für das sogenannte "Waldglas" abgibt. Erst später
verbreitete sich das Wissen darum, wie sich dieser Grünstich mit Hilfe von
Manganverbindungen – der sogenannten Glasmacherseife – vermeiden und
klares, durchsichtiges Glas herstellen lässt.

Weitere Indizien dafür, dass es sich beim Tegernauer Krone-Fläschchen um
ein "Frühwerk" der hiesigen Glasmacherei handelt, sieht der Fachmann in
der sehr dünnwandigen Ausführung des Glases, im hohen Grad der
Verunreinigung und der Vielzahl der im Glas eingeschlossenen Luftblasen.
Dass es in der Region und speziell im Kleinen Wiesental (Wander-)Glashütten
gab, war durchaus bereits bekannt. Acht Glashütten sind allein im Kleinen
Wiesental nachgewiesen, so etwa in Sallneck um 1550, in Wambach um 1585
oder in Stockmatt um 1600, bei etlichen weiteren Standorten werden weitere
Glashütten vermutet. Dabei stand das Kleine Wiesental nicht allein in der
Region: Weitere ca. 50 Nachweise gibt es für das Große Wiesental (Raum
Zell, Hasel, Gersbach) und die angrenzenden Regionen. Ihre Blütezeit
hatten die Glashütten im Kleinen Wiesental den bisherigen Erkenntnissen
zufolge im 17. Jahrhundert.
Dass die Glashütten trotz ihrer offenkundig immensen Bedeutung relativ
wenig Spuren hinterlassen haben, ist den Besonderheiten dieses
geheimnisumwitterten Handwerks geschuldet. Die Glasmacher waren aufgrund
ihres exorbitanten Holzverbrauchs alle paar Jahrzehnte – wenn der Wald in
der Umgebung gerodet war - gezwungen, einen neuen Standort zu suchen. Im
Zuge dieser Standortwechsel brachen die Handwerker ihre Zelte ab und das
wortwörtlich: Sie zerstörten ihre Öfen und bauten ihre Siedlungen
vollständig zurück. Maßnahmen, die offenbar dafür sorgen sollten, dass
keine Hinweise auf das Wissen und Können um die Glasherstellung
zurückblieben und das Geheimnis der Glasmacherkunst bewahrt wurde.
Mindestens ebenso spannend und aufschlussreich wie die äußere Gestalt des
Krone-Fläschchens ist sein Innenleben: Schon gleich beim Auffinden fiel
eine vertrocknete Substanz im Inneren der Flasche auf, aller
Wahrscheinlichkeit nach die Reste eines Weihrauch-Weihwasser-Gemisches.
Damit ergibt sich bei der Suche nach der Bedeutung des Fundstückes eine
ganz neue Deutungsebene: Vermutlich sollten das Haus und seine Bewohner
mit dem Deponieren eines solchen Gegenstandes vor Unheil jeder Art, vor
Hexen und bösen Geistern geschützt werden.
Ein solcher Brauch legt ein katholisches Umfeld nahe. Da unsere Region nun
1555 evangelisch wurde, mag hier ein weiteres Indiz für das bemerkenswerte
Alter des Krone-Fläschchens vorliegen. Andererseits, es hielt sich so
mancher katholische Brauch im Verborgenen auch unter dem neuen Glauben.
Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass das Fläschchen erst nach der
Reformation vergraben wurde. Zugleich legt der Fund nahe, dass das
Krone-Gebäude - zumindest in seinen Fundamenten - schon vor der ersten
Erwähnung des Gasthauses im Jahr 1735 existierte.

Hans Viardot geht gar davon aus, dass das Ursprungsgebäude eines der
ersten Häuser Tegernaus war, welches im Jahr 1113 seine erste urkundliche
Erwähnung fand. Im Gesamtpaket aus Alter und Schutzzauber-Funktion ist das
Krone-Fläschchen "ein Schatz, der absolut einzigartig ist", schreibt
Werner Störk dem Team des Wirtshausmuseums Krone ins Stammbuch.
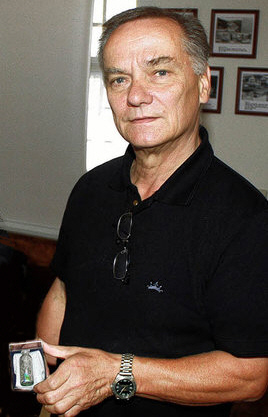
Zu bestaunen ist das Kleinod derzeit freilich nur zu ausgewählten
Gelegenheiten. Mangels adäquatem Präsentationsort wird das Fundstück
derzeit nur zu besonderen Führungen aus seinem sicheren Verwahrungsort
hervor geholt. Wünschenswert wäre, dass die Kostbarkeit einen sicheren
Platz im Hausgang der Krone fände, so Hans Viardot.
Quelle: Badische Zeitung; Original-Artikel: Anja Bertsch:
"Ein Schatz, der einzigartig
ist",
12. 09.2015
Text-Bearbeitung: Webmaster;
Fotos: KuK/H. Viardot (1+2); Anja Bertsch (3+4)
|