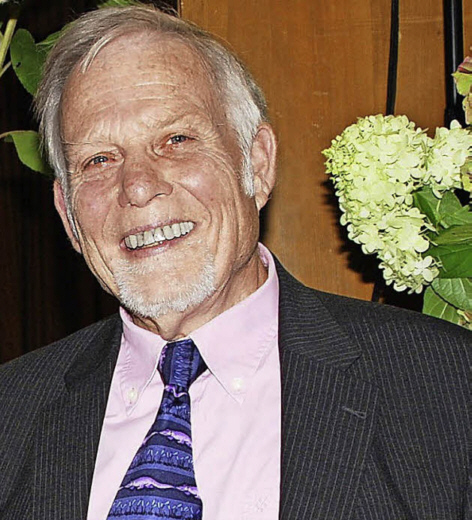| zurück |
|
Die Chronik der sonntäglichen "Krone - Frühschoppen" |
|
|
Wenige Menschen lebten in bescheidenen Verhältnissen Professor Klaus Schubring klärt offene historische Fragen zum Kleinen und zum oberen Wiesental
Viele Gemeinden in der Region feiern in diesem Jahr ihre Ersterwähnung vor 900 Jahren mit großen Dorfjubiläen. Diese Ersterwähnung ist niedergelegt in Abschriften über eine Schenkung, die Walcho von Waldeck im Jahre 1113 an das Kloster St. Blasien vollzog. Was vor 900 Jahren vor sich gegangen ist und in welchem Zusammenhang es zu sehen ist, das ließ Professor Klaus Schubring kürzlich in einem Vortrag in der Tegernauer „Krone" lebendig werden und klärte dabei zusätzlich einige Fragen, über die bis heute diskutiert wird. Dass auf Urkunden und Dokumente gestützte Geschichtsforschung keine staubtrockene Angelegenheit ist, sondern einer auf detektivischer Kleinarbeit gründender Abenteuergeschichte ähneln kann, das erfuhr jeder, der dem emeritierten Geschichtsprofessor lauschte. So spannte er bei seinem Vortrag in der Krone einen Bogen über die europäische Geschichte des 12. Jahrhunderts, um sich den Fragen zu nähern, warum Walcho seinen ganzen Besitz dem Kloster St. Blasien schenkte. Dabei beantwortete er auch die Fragen, ob Schönau - wie gemunkelt wird - von Tegernau aus gegründet oder ob das obere Wiesental aus dem Kleinen Wiesental heraus besiedelt wurde. Von Walchos Schenkung gibt es kein Originaldokument, sondern sie ist in Abschriften in deutscher Sprache aus dem 15. Jahrhundert erhalten. „An der Schenkung selbst kann kein Zweifel bestehen", erklärte Klaus Schubring seinen Zuhörern. In der deutschen Übersetzung ist noch deutlich die frühere lateinische Diktion zu erkennen, und die für Schenkungen im 12. Jahrhundert typischen Klauseln sind im Text vertreten. Aber warum schenkt ein Adliger seinen ganzen Besitz, mit kleinen Ausnahmen, die er für die Familie zurückbehält, an ein Kloster, in das er dann selbst als Laienbruder eintritt? Um diese Frage beantworten zu können, nahm Professor Schubring seine Zuhörer mit auf eine Reise durch das Europa des 11. und 12. Jahrhunderts und ging besonders auf den Investiturstreit ein, der damals das Abendland zu spalten drohte. War es über Jahrhunderte die übliche Praxis gewesen, dass die Könige die Bischöfe in ihrem Regierungsgebiet einsetzten (investierten, die Amtseinsetzung war die Investitur), so kam es im 11. Jahrhundert zum offenen Streit zwischen König und Papst, als Papst Gregor VII. 1075 die Investitur von Bischöfen durch Laien bei Strafe der Exkommunikation verbot. Der Investiturstreit wurde zwar durch den berühmten „Gang nach Canossa" offiziell beigelegt, aber die Macht des Königtums war schwer erschüttert. Ehrgeizige Adlige und aufstrebende Ritter suchten nach mehr Einfluss und Macht, und es entbrannte ein mehr als 40 Jahre währender Kampf, bis sich die Strukturen wieder einigermaßen eingespielt hatten. In diese Zeit fällt auch Walchos Schenkung. „Man darf annehmen, dass die Erschütterung der überkommenen Ordnung durch den Streit zwischen Kirche und Reich sowie durch die aufstrebenden Ritter, die sich nach dem alten „Blutadel" im „Schwertadel" ihren Platz zu sichern suchten, bei Menschen wie Walcho von Waldeck eine tiefe Verunsicherung ausgelöst haben", erklärte Professor Schubring. Die Sicherheit, die das frühere Leben geboten hatte, schien jetzt nur noch in der Kirche und im Glauben zu liegen. „Es war die Suche nach der Heilsvergewisserung, die zahlreiche Adlige in dieser Zeit dazu bestimmte, ihr Leben in einem Kloster zu beschließen, dem sie dann ihren Besitz ganz oder teilweise schenkten", schloss Klaus Schubring diesen Teil. Blieben die Fragen nach der Rolle Tegernaus und des Kleinen Wiesentals in dieser Zeit. Tegernau kommt in der Schenkungsliste des Walcho nicht vor, sondern wird erst im Jahr 1114 erstmalig erwähnt, als über einen Prozess berichtet wird, den der Pfarrer Guntram von Tegernau gegen das Kloster St. Blasien wegen entgangener Zehntabgaben in Schönau führte. „Die Abgaben, die der Pfarrer für Tegernau vom Kloster forderte, waren vor Walchos Schenkung an die Pfarrei Tegernau gegangen", berichtete Professor Schubring, „und es handelte sich um erhebliche Abgaben." Darum muss davon ausgegangen werden, dass die Pfarrei und damit auch Tegernau schon vor 1114 bestanden. „Es ist also ganz in Ordnung, wenn Tegernau in diesem Jahr seinen 900. Geburtstag feiert", konnte der Professor seine Zuhörer und Ortsvorsteher Ernst Kallfaß beruhigen. Aber bedeutet dieser Rechtsstreit, dass Schönau von Tegernau gegründet oder vom Kleinen Wiesental her besiedelt wurde? Hier musste Professor Schubring beide Male negativ antworten. Die Abgaben, die Pfarrer Guntram einforderte, bezogen sich auf Ländereien, die Walcho in Schönau besaß, und die er früher der Pfarrei Tegernau zugesprochen hatte. Eine Pfarrzugehörigkeit von Schönau nach Tegernau könne daraus nicht abgeleitet werden, so Schubring. Und auch eine Besiedelung aus dem Kleinen Wiesental heraus ist alles andere als wahrscheinlich. Die letzte Frau von Rotenburg leistete ihre Zehnten noch im 13. Jahrhundert in Form von Schweinen. „Von Abgaben in Korn oder Rindern ist keine Rede", so Professor Schubring. „Das bedeutet, dass das Tal noch arm war und dass Schweine, die einfach in die Eichen- und Buchenwälder getrieben wurden, einen wesentlichen Teil des Lebensunterhalts ausmachten", erläuterte Klaus Schubring. Daraus muss man entnehmen, dass im Kleinen Wiesental recht wenige Menschen und dazu in eher bescheidenen Verhältnissen lebten. „Das macht eine Besiedelung des oberen Wiesentals aus dem Kleinen Wiesental heraus mehr als unwahrscheinlich", schloss Professor Schubring.
Bericht: MT / Heiner Fabry
|
|